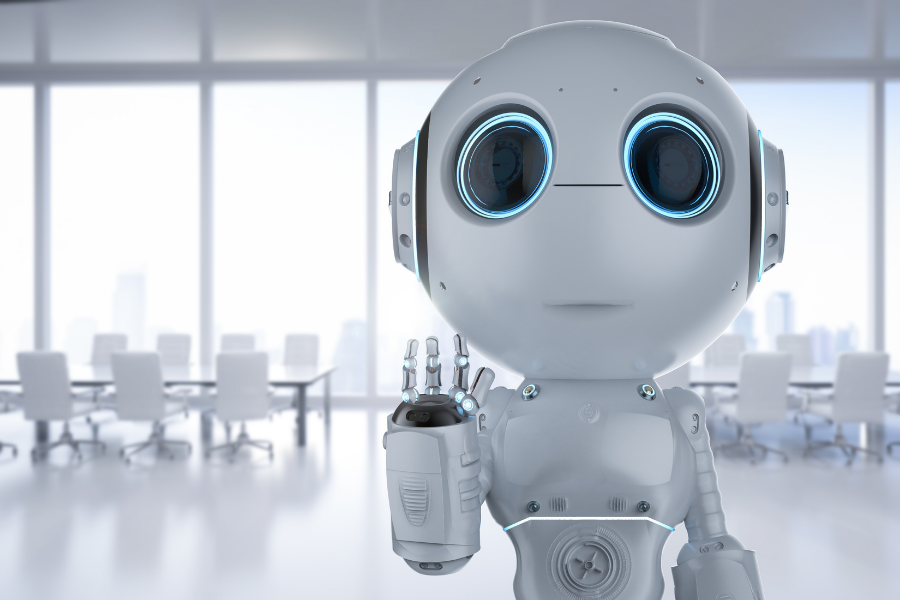Wie verändern Smartwatches, Fitness-Tracker und digitale Tools die medizinische Versorgung?
Herzfrequenz, Stresslevel, Schlafqualität – moderne Wearables erfassen längst eine Vielzahl gesundheitsrelevanter Daten. Doch was bedeutet das für Prävention, Diagnostik und Therapie?
Diese Frage stand am 29. Oktober im Mittelpunkt der vierten Ausgabe von „Gesundheitsversorgung in Sachsen-Anhalt – Quo vadis?“, organisiert von der Impetuum GmbH, der Techniker Krankenkasse (TK) und der Translationsregion für digitalisierte Gesundheitsversorgung (TDG).
Im Mitteldeutschen Multimediazentrum (MMZ) in Halle (Saale) trug mehr als die Hälfte des Publikums eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker – und laut einer spontanen Umfrage von Moderator Dr. Ingmar Rothe hatten 81 Prozent bis 11:24 Uhr noch weniger als 5000 Schritte gemacht. Obwohl nicht repräsentativ zeigten die Ergebnisse: Digitale Gesundheit ist bereits im Alltag angekommen, doch ihr Potenzial für die Versorgung wird noch längst nicht ausgeschöpft.
Prof. Dr. med. Daniel Sedding machte in der Podiumsdiskussion der Veranstaltung deutlich, dass die Qualität vieler Geräte mittlerweile so hoch ist, dass etwa Vorhofflimmern zuverlässig erkannt werden kann: „Die EKG-Daten aus modernen Smartwatches sind so valide, dass wir darauf medizinische Diagnosen stützen können,“ sagte der Kardiologe vom Universitätsklinikum Halle (Saale).
Auch Prof. Patrick Jahn, Versorgungsforscher und Projektleiter der TDG, betonte die Bedeutung der Selbstvermessung: Digitale Tools fördern das Selbstmanagement von Patientinnen und Patienten und schaffen neue Möglichkeiten für eine individualisierte Versorgung. „Es ist nun die Aufgabe, diese Möglichkeiten ins therapeutische Spektrum einzubringen und den Nutzen zu untersuchen.“
Sönke Steiner, Wearable-Experte von Polar, verwies auf die rasante technologische Entwicklung: „Die Geräte sind der Regulierung oft mehrere Schritte voraus. Es ist jedoch schwierig, sie als Medizinprodukte zuzulassen, wenn sich die Technik alle sechs Monate weiterentwickelt.“
Gesundheitskompetenz und Datenschutz als Schlüsselthemen

Steffi Suchant, Leiterin der TK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt, brachte die Perspektive der Krankenkassen ein: „Wir haben erstmals die Chance, Gesundheitsdaten sinnvoll auszuwerten und Versicherten gezielte Angebote zu unterbreiten. Doch der Datenschutz macht es oft schwer, das Potenzial dieser Daten voll zu nutzen.“
Sie betonte zugleich, wie wichtig Gesundheitskompetenz und Digitalkompetenz seien: „Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie ihre Gesundheitsdaten interpretieren können. Wir müssen früh ansetzen – in Schule und Alltag – um den bewussten Umgang mit Gesundheit zu fördern.“
Künstliche Intelligenz als neue Dimension der Versorgung
Ein weiteres zentrales Thema der Diskussion war der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen. Sönke Steiner zeigte, wie KI bereits in Trainingssteuerung und Datenanalyse genutzt wird: „KI kann therapeutische Vorschläge machen, die wir bisher gar nicht bedacht haben – aber am Ende bleibt der Mensch entscheidend.“
Ein Aspekt, den auch Daniel Sedding ins Spiel brachte: „Wir haben mehr Daten, als wir bewältigen können – nicht nur analytisch, sondern auch organisatorisch. Uns fehlt Personal, um Daten sinnvoll auszuwerten und in die Versorgung zu überführen.“ Ein neues Feld, auch für die Lehre der Pflege und Medizin. „KI überrollt uns“, sagte Dr. Dietrich Stoevesandt. „Wir brauchen Hilfe in der Datenflut und müssen Studierenden eine kritische Betrachtung der Daten beibringen. Sie müssen erkennen, ob sie valide und verlässlich sind“, so der Leiter des Dorothea Erxleben Lernzentrums.
„KI sehe ich als große Möglichkeit, mit den Datenmengen umzugehen, das kann kein Mensch mehr bewältigen“, sagte Patrick Jahn. „Dabei brauchen wir alle Akteure, die daraus einen mutigen Schritt für die Zukunft der Versorgung entwickeln“, so Jahn zum Ende des Podiums. „Unser Ziel muss es sein, jedem Menschen die notwendige Versorgung zu ermöglichen. Das ist eine Aufgabe für uns alle.“
Austausch auf Augenhöhe – für eine vernetzte Gesundheitsregion
Dass die Bereitschaft, sich einzubringen da ist – und das im direkten persönlichen Austausch –, zeigte sich im MMZ an diesem Tag ganz deutlich. Sowohl beim anschließenden Speedmatching als auch bei den Expert:innentalks in kleineren Runden war die Beteiligung rege und der Redebedarf hoch.
„Genau solche Veranstaltungen bringen die richtigen Leute zusammen“, so Dr. Andreas Lauenroth von der mit veranstaltenden Impetuum GmbH. „Versorgung, Wirtschaft, Wissenschaft, Krankenkassen und Gesellschaft kommen ins Gespräch. Nur so können wir gemeinsame Lösungen finden.“

Hannah Dinklage, Besucherin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Versorgungsforschung, hob hervor, wie wichtig auch für sie die unterschiedlichen Perspektiven sind. Besonders spannend war für sie, wie die Krankenkasse das Thema Datenschutz beleuchtet hat: „In der Versorgungsforschung will man Gesundheitsdaten sammeln und freut sich über die ganzen technischen Möglichkeiten, die es bereits gibt. Dass die Herausforderung mit dem Speichern der Daten auf Servern im Ausland groß ist, hatte ich natürlich schon auf dem Schirm, wie groß sie wirklich ist, wurde mir heute aber noch einmal klarer.“
Sie kam als Patientin, um etwas über den Stand der Digitalisierung im Bereich Herzgesundheit zu erfahren: Gundula Fiedler. Die Seniorin bezeichnet sich selbst als „technikverrückt“ und trägt auf Rat ihrer Kardiologin eine Smartwatch. Sie zeigte sich von den Vorträgen und Gesprächen beeindruckt: „Man merkt, wie viel Forschung und Engagement dahinterstecken. KI ist für viele noch beängstigend, aber die Veranstaltung hat gezeigt, dass sie großes Potenzial hat, Leben zu verbessern.“
Fazit: Kompetenz, Kooperation und Mut zur Veränderung
Im Fazit waren sich alle einig: Digitale Gesundheitsversorgung bietet enorme Chancen – von der Früherkennung über die personalisierte Therapie bis zur Kostenreduktion im Gesundheitssystem. Doch um diese Potenziale zu nutzen, braucht es mehr Kompetenz im Umgang mit Gesundheitsdaten, klare Rahmenbedingungen für Datenschutz und Interoperabilität und vor allem Mut zur Zusammenarbeit.
Ein klarer Auftrag für eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe? „Diese Ausgabe hat gezeigt, dass sich das Format verstetigt. Ich freue mich, dass immer neue Protagonisten mit dabei sind. Das wir nicht immer uns eine eigene Blase bilden“, sagte Steffi Suchant. „Wir müssen noch ein bisschen mehr trommeln, weil das Thema so wichtig ist, dass unser Event durchaus noch mehr Zuspruch haben könnte. Man lernt hier so viele neue Menschen kennen und neue Perspektive, dass sich diese Veranstaltung einfach lohnt.“
Dass es weiter geht, steht auch für Patrick Jahn fest. „Die Themen werden uns in der Digitalisierung auch in den nächsten Jahren garantiert nicht ausgehen“, so der TDG-Projektleiter. „Wichtig ist, dass wir den Spirit und die Offenheit dieser Veranstaltung und aller Akteure beibehalten. Das ist die Besonderheit dieses Formats.“
Fotos: Carolin Unrau