PROJEKTPARTNER:INNEN
Mitteldeutsches Herzzentrum
Prof. Dr. med. Daniel Sedding
Website Mitteldeutsches Herzzentrum
AG Versorgungsforschung | Department für Innere Medizin, Universitätsmedizin Halle (Saale)
Prof. Dr. Patrick Jahn, Laura Rothmann & Madeleine Ritter-Herschbach
Website der AG Versorgungsforschung
iMedCom
Dr. Hasan Bushnaq
www.imedcom.com
TDG-Ansprechpartnerin
Dr. Anja Wolf
PROJEKTINFORMATIONEN
Laufzeit: 12/2021 – 11/2023
Vorhabenskosten: 600.000 Euro
WEITERE INFORMATIONEN
– Steckbrief TDG-Trendreport (Juni 2022)
Herzinsuffizienz oder auch Herzschwäche ist der häufigste Grund einer Krankenhauseinweisung bei Patient:innen über 65 Jahren. Weltweit erkranken jährlich mehr als 37,7 Millionen Personen neu an dieser Krankheit. Bei Herzinsuffizienz wird der Herzmuskel immer schwächer, was zu einer verminderten Blutversorgung der Organe führt. Symptome sind unter anderem eine nachlassende Leistungsfähigkeit, Atemnot, Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme. Im fortgeschrittenem Stadium versterben 60 Prozent der Patient:innen innerhalb eines Jahres. Frühzeitig erkannt und mit einem leitliniengerechten Versorgungskonzept, lässt sich jedoch der Krankheitsverlauf bremsen und die Lebensqualität lange aufrechterhalten. Genau hier setzt das TDG-Projekt DigitHAL HF-Net mit einem digital gestützten Versorgungskonzept an. Davon können vor allem Patient:innen in Sachsen-Anhalt profitieren, das leider die höchste Sterbequote im bundesweiten Vergleich bei Herzinsuffizienz aufweist.
„Herzinsuffizienz ist eine chronische Krankheit, die aufgrund der Symptomatik und komplexen Therapieregime mit erheblichen Einschränkungen verbunden ist und schließlich mit dem Tod endet. Die Patient:innen müssen mit der Krankheit leben lernen, umfassend ihren Lebensstil daran anpassen. Das setzt ein gewisses Maß an Gesundheitskompetenz und ausgeprägte Selbstmanagementfähigkeiten der Patient:innen voraus. Durch das hybride Konzept aus fachärztlicher und pflegerischer Betreuung, kombiniert mit den Vorteilen von Telemonitoring bzw. Televisite erwarten wir eine hohe Therapietreue der Patient:innen, um ihnen auch unnötige Krankenhausaufenthalte zu ersparen“, sagt Prof. Dr. Daniel Sedding vom Mitteldeutschen Herzzentrum aus Halle, der das TDG-Projekt leitet.
Eben diese Therapietreue soll durch das Projekt verbessert werden. Therapietreue gibt an, wie sehr sich Patient:innen und Ärzt:innen an den vereinbarten Behandlungsplan halten oder halten können. In der stark ländlich geprägten TDG-Region sind Nachsorgetermine sehr weitläufig anberaumt und es existiert eine medizinische und pflegerische Mangelversorgung. Diese Versorgunglücke möchte das Mitteldeutsche Herzzentrum, wissenschaftlich begleitet durch die AG Versorgungsforschung der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität, zusammen mit dem Unternehmen iMedCom anlässlich des Projektes DigitHAL schließen.
Ziel ist die Entwicklung einer digital gestützten Versorgungsstruktur: Eine webbasierte Anwendung in Kombination mit einer parallelen (online) Betreuung durch Expert:innen und bereitgestellten evidenzbasierten Gesundheitsinformationen soll die Versorgungslücke schließen. Patient:innen übermitteln von zu Hause aus mittels Tablet ihre Vitaldaten und allgemeines Befinden an ihr Behandlungsteam. Dazu zählen Werte wie Blutdruck, Gewicht, Puls und eine Einschätzung des persönlichen Befindens. Über das Tablet können sie sich außerdem über eine auf ihre Bedürfnisse angepasste digitale Patientenbibliothek informieren. Termine mit Therapeut:innen erfolgen über Videochat, in denen bei Bedarf die therapeutischen Empfehlungen angepasst und gemeinsam abgestimmt werden.
Als technologische Plattform dient die Software-Anwendung von iMedCom. Das Startup aus Halle wurde 2018 von Medizinern gegründet und hat eine Kommunikationsplattform für Patient:innen und Ärzt:innen entwickelt, die bereits erfolgreich im Einsatz ist. „Versorgungsdefizite im stationären Bereich und in der Niederlassung werden unvermeidbar bzw. sind bereits Realität. Dies zeigt sich als zunehmende Problematik in der ambulanten Versorgung chronisch kranker Patient:innengruppen wie der mit Herzinsuffizienz. Im Rahmen des Projektes passen wir unsere modulare Plattform speziell auf die Anforderungen dieser Zielgruppe an. Neben einer besseren Versorgung ist es unser Ziel, die digitale Kommunikation und den Austausch zwischen Patient:innen, Ärzt:innen, Pfleger:innen sowie Krankenkassen zu etablieren“, sagt Dr. Hasan Bushnaq, Medical Director und Co-Founder von iMedCom.
Damit dies gelingt, arbeitet das DigitHAL-Projektteam mit Hochdruck an der Umsetzung. Aktuell werden der technische Prototyp und das Studienprotokoll für die Ethikkommission erstellt. Zudem finden Gespräche mit Expert:innen statt und das Team befindet sich in einem Erfahrungsaustausch mit Kliniken, die bereits telemedizinische Prozesse verwenden. Inhalte für die digitale Patientenbibliothek werden recherchiert, zudem audio-visuell mittels Erklärvideos aufbereitet. Im Sommer 2022 startet die klinische Testphase der Studie, in der das digitale Versorgungskonzept erprobt werden soll. Patient:innen testen das Versorgungsmodell über einen Zeitraum von 6 Monaten. Ständiges Feedback aller Anwender:innen und kontinuierliche Anpassungen sowie Verbesserungen an der Software, der Informationsfülle und -qualität sowie des Versorgungsprozesses durch das Behandlungsteam, sollen bis Oktober 2023 zu einem positiven Ergebnis in puncto Machbarkeit und Akzeptanz führen. Im Fokus der Bemühungen des Projektteams steht die Entwicklung eines praxistauglichen Versorgungskonzeptes für Herzinsuffizienz-Patient:innen über die Sektorgrenzen hinaus, auch durch Aufnahme des digitalen Therapieangebotes in den Leistungskatalog der Krankenkassen.
„Durch die gute Vernetzung des Mitteldeutschen Herzzentrums mit vielen Klinikpartner:innen können wir bei positiven Ergebnissen eine wirtschaftliche Verwertung des Versorgungskonzeptes unterstützen, damit es auch in der Breite Anwendung findet und sowohl von Ärzt:innen und Pflegefachpersonal gelebt, als auch von unseren Patient:innen angenommen wird“, sagt Prof. Sedding.
Inwieweit dieser Ansatz zu einer Verbesserung der Lebensqualität und zu einer Reduzierung der Sterbequote führen kann, muss langfristig untersucht werden. „Dadurch, dass der gegenwärtige Therapiestandard digitalisiert wird und mehreren, wenn nicht gar allen Patient:innen überhaupt angeboten werden kann, erreichen wir bereits eine Optimierung der medizinischen Versorgung, die mich als Mediziner sehr zufrieden stimmt“, sagt Dr. Bushnaq.


Probleme in der Pflege heute – Lösungen für morgen
Herausforderungen und Ideen aus dem Alltag von Pflegekräften
Datum: Individuell vereinbar
Dauer: 60 Minuten
Ort: (vorerst) digital
Kosten: kostenlos
Teilnehmeranzahl: max. 10 Personen
Referent:in: Mitarbeiter:in TDG Bündnismanagement

Sie arbeiten in der Pflege? Geht es um die Gegenwart in ihrer Branche, kennen Sie die täglichen Herausforderungen am besten. Denken Sie an die Zukunft, wissen Sie genau, was Sie anders oder besser machen würden? Sprechen wir darüber!
Wir möchten Ihren und den Alltag von Pflegebedürftigen durch den Einsatz und die Entwicklung innovativer Lösungen verbessern. In diesem Mitmach-Format geht um den Austausch mit Ihnen, denn Sie sind der Experte/die Expertin. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie Probleme mit bereits vorhandenen Innovationen gelöst werden können. Oder welche Lösungen es in Zukunft braucht, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.
Bei Interesse schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir gestalten unsere Mitmach-Formate individuell und passen sie bedarfsorientiert an Sie an.
Für wen? Pflegefachkräfte, pflegende Angehörige, Interessierte, Pflegebedürftige.
Pflege-Innovationen in die Praxis integrieren – aber wie?
Austausch-Format für Entscheider*innen in der Pflegewirtschaft
Datum: Individuell vereinbar
Dauer: 60 Minuten
Ort: (vorerst) digital
Kosten: kostenlos
Teilnehmeranzahl: max. 5 Personen
Referent:in: Mitarbeiter:in TDG Bündnismanagement

Innovationen im Bereich der Pflegewirtschaft sind bereits vorhanden. Durch TDG-Projekte kommen neue dazu. Neben den Anwender:innen und Betroffenen, für die diese Lösungen entwickelt werden, benötigt es Entscheider:innen im Bereich Pflege und Gesundheit.
Sie sind Leiter:in einer Pflegeeinrichtung oder Pflegedienstleister? Sie haben auf kommunaler Ebene Verantwortung für die Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen? Sie möchten neue Lösungen in ihrer Einrichtung integrieren oder neue Ideen mitentwickeln und Pflege künftig erleichtern? Dann ist dieses Mitmach-Format genau das Richtige für Sie.
Wir stellen Ihnen aktuelle Innovationen vor. Erklären Ihnen, wie Innovationen entstehen und diskutieren mit Ihnen, wie Innovationen in die Praxis und damit in den Alltag von Millionen von Betroffenen überführt werden können. Lassen Sie sich von uns informieren und inspirieren.
Bei Interesse schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir gestalten unsere Mitmach-Formate individuell und passen Sie bedarfsorientiert an Sie an.
Emotions-Roboter, schlaue Spiegel & Co.
Digitale Innovationen kennenlernen und diskutieren
Datum: Individuell vereinbar
Dauer: 60 Minuten
Ort: (vorerst) digital
Kosten: kostenlos
Teilnehmeranzahl: max. 10 Personen
Referent:in: Mitarbeiter:in TDG Bündnismanagement
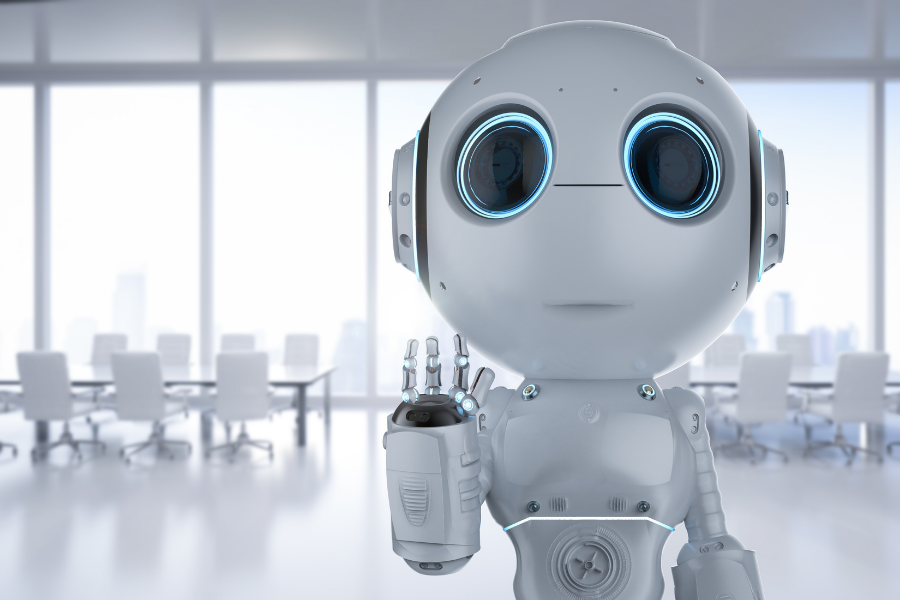
Innovationen in der Pflege sollen alltägliche Abläufe unterstützen und das Leben von Pflegebedürftigen sowie von Pflegenden vereinfachen und verbessern. Bereits heute gibt es zahlreiche Lösungen, die zu mehr Mobilität und Selbstversorgung führen. Zudem können kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie das Alltagsleben mit sozialen Kontakten durch Innovationen aufrechterhalten bleiben.
In unserem Mitmach-Format geben wir Ihnen Einblicke in bereits bestehende Innovationen und erklären, wie Sie diese in Ihren Alltag integrieren können. Lassen Sie sich überraschen, was es neben Emotions-Robotern, digitalen Tablettenspendern, intelligenten Spiegeln oder elektrischen Rollatoren heute schon gibt.
Wir führen Sie (vorerst) digital an diese Innovationen heran und diskutieren mit Ihnen über Stärken, Schwächen und die Alltagstauglichkeit.
Bei Interesse schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir gestalten unsere Mitmach-Formate individuell und passen sie bedarfsorientiert an Sie an.
Für wen? Pflegefachkräfte, pflegende Angehörige, Interessierte, Pflegebedürftige